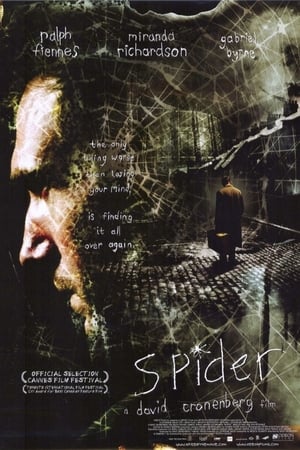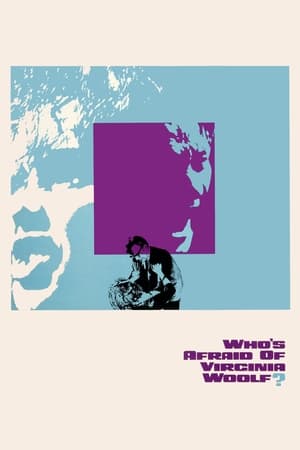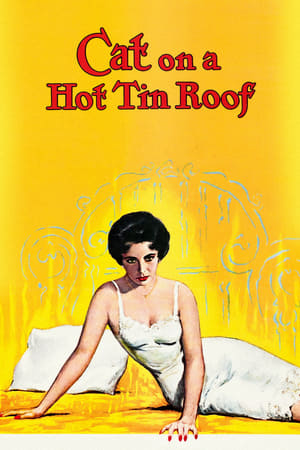Quelle: themoviedb.org
 Trailer
Trailer

- Start 23.03.1978
- 137 Min MysteryDrama USAUK
- Regie Sidney Lumet
- Drehbuch Peter Shaffer
- Cast Richard Burton, Peter Firth, Colin Blakely, Joan Plowright, Harry Andrews, Eileen Atkins, Jenny Agutter, Kate Reid, John Wyman, Elva Mai Hoover, Ken James, Patrick Brymer, Sufi Bukhari, David Gardner, James Hurdle, Frazier Mohawk
Inhalt
×