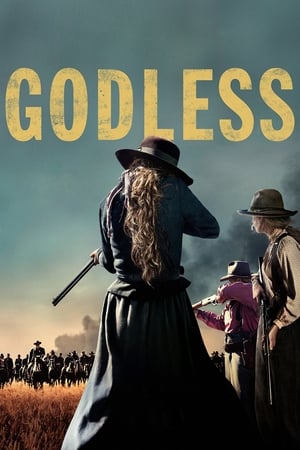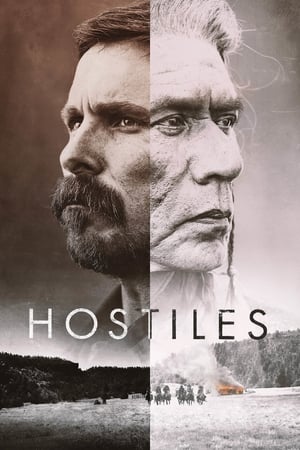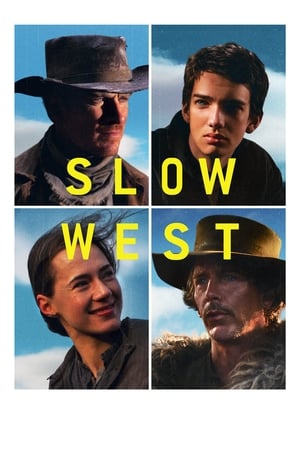Es ist ein Dilemma, das nicht leicht zu lösen ist: Wenn ein Film untrennbar mit einem tragischen Vorfall verknüpft ist, lässt sich schwer zwischen Werk und Wirklichkeit unterscheiden. Als The Crow - Die Krähe 1994 in die Kinos kam, war es nahezu unmöglich, die künstlerische Qualität losgelöst vom Tod Brandon Lees zu bewerten. Sein Schicksal überschattete jede Szene, jede Kamerabewegung. Wer wagt es schon, ein Kunstwerk nüchtern zu kritisieren, wenn dessen Entstehung mit dem Verlust eines Menschenlebens verbunden ist?
Auch bei Rust ist die Fallhöhe gewaltig – und doch in vielerlei Hinsicht noch komplexer. Am Set des Westerns kam es 2021 zu einem fatalen Zwischenfall: Alec Baldwin, Hauptdarsteller und Produzent, erschoss versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins und verletzte den Regisseur Joel Souza schwer. Was folgte, war ein monatelanger Sturm aus medialer Aufmerksamkeit, juristischen Auseinandersetzungen und hitzigen Diskussionen über Sicherheitsstandards bei Independent-Produktionen. Der Film selbst rückte dabei in den Hintergrund – beinahe vergessen unter der Last der Tragödie.
Und doch: Im Frühjahr 2025 findet Rust tatsächlich seinen Weg in die deutschen Kinos. Es ist eine berechtigte, ja notwendige Frage, ob dies aus echter künstlerischer Überzeugung geschieht – oder ob es vielmehr die morbide Faszination ist, die ein Werk umgibt, das von einem realen Schicksalsschlag gezeichnet ist. Schon bei The Crow trieb genau diese Ambivalenz viele Zuschauer in die Säle – eine Form des Interesses, die gleichzeitig menschlich verständlich und doch zutiefst problematisch ist: Sie wird weder der Kunst noch den Schicksalen der Beteiligten gerecht.
Wie also spricht man über einen Film, der unausweichlich im Schatten einer Katastrophe steht, der Projektionsfläche für Erwartungen, Meinungen und moralische Dilemmata geworden ist? Vielleicht am besten, indem man den Versuch wagt, ihn in seinem künstlerischen Eigenwert ernst zu nehmen. Rust ist – bei aller Bruchstückhaftigkeit – ein Film, der zumindest diesen Versuch verdient hat.
Joel Souza (Im Netz der Gewalt) erzählt darin die Geschichte des gesuchten Outlaws Harland Rust, der seinen 13-jährigen Enkel Lucas vor dem Galgen bewahren und mit ihm nach Mexiko fliehen will. Inhaltlich mag das konventionell klingen, doch die Inszenierung macht früh deutlich, dass Souza weit mehr als eine bloße Genreübung im Sinn hatte. Bereits die erste Einstellung verneigt sich unmissverständlich vor Sergio Leone, weitere Referenzen an Howard Hawks, Fred Zinnemann und Sergio Corbucci folgen – nicht als bloße Zitate, sondern als Ausdruck aufrichtiger Bewunderung.
Visuell oszilliert der Film zwischen harscher Italo-Western-Fragmenten und klassischem amerikanischem Mythos. Staubige Straßen, Holzhütten, prügelnde Cowboys und klirrende Pianosalons prägen das Bild. In der Figur des Kopfgeldjägers Fenton (Travis Fimmel, Dune: Prophecy), verkörpert mit bedrohlicher Präsenz, blitzen gar Reminiszenzen an Klaus Kinski aus Leichen pflastern seinen Weg auf – ein Versuch, dem Western seine existenzielle Tiefe zurückzugeben.
Doch Rust wirkt dabei oft uneinheitlich. Die Tonalität schwankt, der filmische Rhythmus bleibt brüchig. Das liegt nicht nur an der wechselhaften Bildsprache – die teils beeindruckende, teils auffallend reduzierte Visualität lässt sich durch die Produktionsbedingungen erklären –, sondern vor allem an der Überfrachtung mit Nebenfiguren. Die Gruppe Marshals, die Harland Rust verfolgt, bleibt in ihrer Charakterzeichnung blass, insbesondere ihr Anführer Wood (Josh Hopkins, Shrinking), dessen innerer Konflikt zwar offengelegt, aber nie konsequent durchdrungen werden.
Auch die religiöse Symbolik, die Souza einstreut, bleibt Behauptung ohne Resonanz. Der Versuch, den Wilden Westen von seinem romantisierten Glanz zu befreien, wirkt bemüht, aber nicht tiefgreifend. So mäandert der Film eher durch seine Geschichte, als dass er ihr mit klarer Dramaturgie folgt. Was bleibt, sind vereinzelte, fast poetische Momente von bildlicher Schönheit – Szenen, in denen das Talent der verstorbenen Kamerafrau Halyna Hutchins aufscheint. Sie zeugen von einem Blick für Tiefe, Licht und emotionale Komposition, der tragisch unvollendet bleiben musste.
Alec Baldwin (Departed: Unter Feinden) als Harland Rust zeigt sich in einer Rolle, die viel verspricht, aber wenig einlöst. Mit grauem Bart und stoischer Miene durchquert er die Szenarien – solide, aber ohne nachhaltige Eindrücklichkeit. Seine Figur bleibt seltsam konturlos, eine archetypische Western-Gestalt ohne jene emotionale Vielschichtigkeit, die große Spätwestern wie Erbarmungslos oder Feinde - Hostiles auszeichnet. Freilich: Ein solcher Vergleich wäre nicht nur unangemessen, sondern auch ungerecht.
Denn Rust ist kein Meisterwerk – aber auch kein reines Kuriosum. Es ist ein Film, der sich aufrichtig bemüht, die große Leinwand zu verdienen, dabei aber oft eher nach spätem Heimkino aussieht. Ein Western, der aus der Zeit gefallen scheint, ohne wirklich zeitlos zu sein – und der doch Spuren hinterlässt. Vielleicht gerade, weil er nicht perfekt ist.