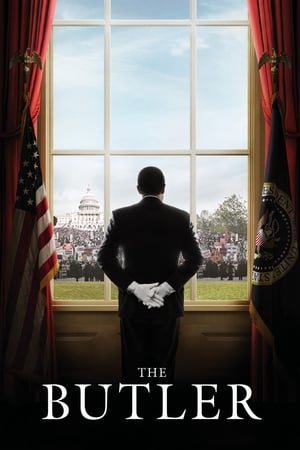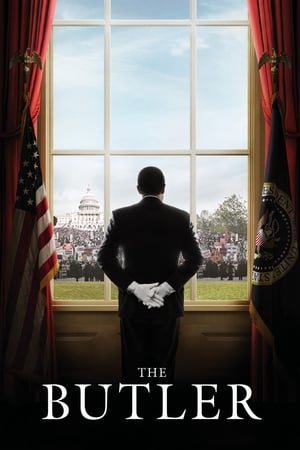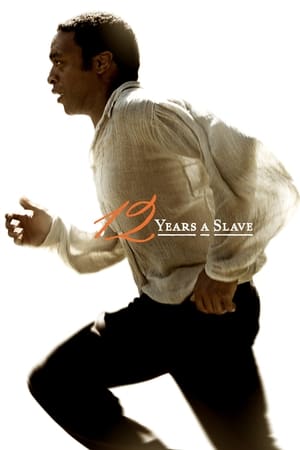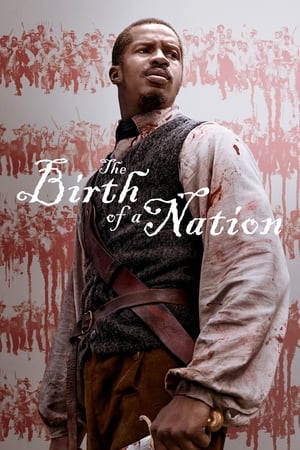Nach wie vor ranken sich unter den Cineasten die verschiedensten Theorien darum, wie Robert Zemeckis' Klassiker Forrest Gump denn nun wirklich zu deuten ist: Versteckt sich hinter der fiktiven Biographie des zurückgebliebenen Jungen aus Alabama, der es trotz seiner kognitiven Schwächen schafft, Teil relevanter historischen Ereignissen zu werden und die Geschichte Amerikas vor allem durch seine liebenswerte Naivität zu beeinflussen, das tarierende Kalkül, dem Zuschauer nur mittels fingerfertigem Spiel auf der manipulativen Gefühlsklaviatur einige Tränen zu entlocken? Oder ist Forrest Gump tatsächlich eine reichlich zynische Abrechnung mit dem American Way of Life, den nicht nur der größte Vollidiot befolgen kann, sondern ihn sogar maßgeblich begründen? Welche der Lesarten nun der eigenen Ansicht am nächsten kommt, ob Zemeckis nur eine astreine Kitschballade oder doch einen galligen Abgesang auf nationale Illusionen inszeniert hat, keimt in der individuellen Perzeption. Fakt ist nur, die Stärke und der Reiz des Mediums liegen oftmals in der puren Interpretationsmöglichkeit. Mit Lee Daniels' Der Butler verhält es sich bei der Betrachtung der inhaltlicher Eckpfeiler relativ ähnlich.
Angelehnt an den Werdegang des Butler Eugene Allen, der von 1952 bis 1986 tatsächlich im Weißen Haus diente und für acht Präsidenten das Silbertablett tagtäglich polierte, erzählt Der Butler vom Plantagenarbeiter Cecil Gaines (Forest Whitaker), der das Leid das Sklaverei am eigenen Körper erfahren musste und schließlich durch seine Disziplin, aber auch dank einer gehörigen Portion Glück, die Chance bekommt, im Weißen Haus tätig zu werden und den Präsidenten, von Dwight D. Eisenhower bis Ronald Reagen, bei ihrer Arbeit auf die Finger zu blicken – Und sie bei Entscheidungen, vor allem in Bezug auf das Bürgerrecht, durch das bloße Erscheinungsbild in die richtige Richtung zu weisen. Gut, Cecil ist gewiss kein Agitator auf höchster politischer Ebene, er übt eher durch seine Würde Einfluss auf die Staatsoberhäupter Amerikas aus und bekommt so einen klar repräsentativen Charakter der afroamerikanischen Bewegung im progressiven Wandel zugesprochen. Cecil ist ein Ausdruck de im stillen Appell geforderten Gleichberechtigung, in dem er sich nicht in den Vordergrund drängt und seiner Loyalität immer den Vorzug vor politische Statements erlaubt: Ein unterschwelliger Mahnruf an das Menschliche, an eine Denke, in der der ethnische Segregation kein Zutritt erlaubt ist.
Um nun aber den Vergleich zu Forrest Gump nicht unberührt zu lassen: Forrest und auch Cecil sind anwesend, wenn Historisches geschieht, ihnen wird dabei eine absolut klare Bedeutung in diesen Prozessen geschenkt und beide sind schlussendlich an einem Punkt in der Gegenwart angekommen, an denen sie auf ihr Leben zurückblicken können und sagen dürfen, dass sie mitverantwortlich dafür waren, dass die Welt ein Stückchen offener, ein Stückchen besser geworden ist. Während sich Forrest Gump seiner Fiktion aber immer im Klaren ist, möchte Der Butler den beschwerlichen Pfad der Afroamerikaners auf der einen Seite realitätsnah zeichnen, ihn zwischen Auflehnung und Akzeptanz porträtieren und strikt konkretisieren, arbeitet er auf der anderen Seite aber mit furchtbar irritierenden Karikaturen der Präsidentschaft, die womöglich satirischen Anliegen befolgen sollten, sich im Kontext der Intention jedoch alles andere als geglückt erweisen und ihr absolut keinen Gefallen tun. Allgemein bietet Der Butler immer genau das, was der Zuschauer auch sieht, weil er sich auf einer Ebene bewegt, auf der das amerikanische Kino keinen Mut besitzt, Doppeldeutigkeiten einzusetzen und den bitteren Kern der Historie in ein Licht zu setzen, welches nicht nur Rührseligkeiten und Flitter beleuchtet.
Der Butler ist letztlich aber kein Film, der das Durchhaltevermögen, die Stärke der Schwarzen honoriert, sondern eine auf Zelluloid gebannte Glitzerwolke, die den Weißen geradewegs in die Karten spielt. Die Afroamerikaner werden ihrer Rebellion (hier in Person von Cecils Sohn, mit dem er sich natürlich entzweit, obwohl die Konflikte der Beiden interessante Ansätze offerieren) gegen Rassismus und Ungerechtigkeit gewiss nicht diffamiert, doch es sind immer die Weißen, die hier etwas bewegen, die es dem „Bimbo“, dem „Hausnigga“ ermöglichen, sogar den Präsidentenstuhl im Weißen Haus zu beziehen. Lee Daniels (The Paperboy) und Danny Strong sind in ihrer Erzählung nicht an Ecken und Kanten interessiert, sie wollen nicht eindringen in die tiefen Wahrheiten oberflächlicher Abstimmungen. Der Butler modelliert ein schmalziges, ein glattes und nicht minder verlogenes Bild vom treuen schwarzen Mann, wie ihn die Weißen sehen wollen, nicht aber, wie er von der ganzen Welt gesehen werden sollte. Und dann, wenn Cecil verstanden hat, dass es vielleicht nicht verkehrt ist, einmal die Stimme zu erheben, ist die Sache eh schon wieder gegessen und Barack Obama neuer Regierungschef: Cecil darf niederknien vor seinen einstigen Chefs, denn der Weiße Mann hat es vollbracht, dass sich der Kreis endlich auch für ihn schließen darf. Hut ab.
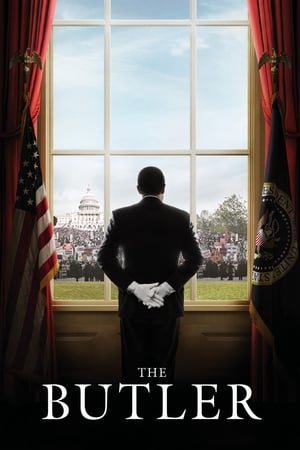 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org