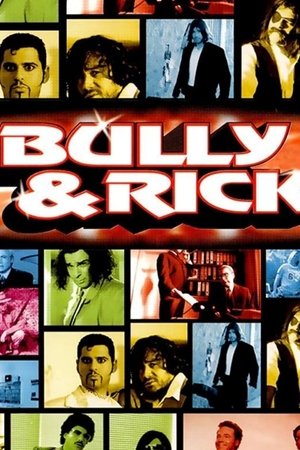Nach dem überaus erfolgreichen Comeback der Nackten Kanone und der offiziellen Ankündigung von Spaceballs 2 scheint sich am internationalen Comedy-Horizont ein waschechtes Spoof-Revival abzuzeichnen. Zwischen Meta-Witz, selbstironischem Overacting und liebevoll-überdrehten Genreparodien kündigt sich eine Rückkehr jener Komödien an, die einst das Kino mit absurden Pointen und anarchischem Humor füllten. Und während Hollywood seine Klassiker neu aufpoliert, liefert Deutschland mit Das Kanu des Manitu nun einen möglichen Vorboten dieser Entwicklung – eine späte Fortsetzung zu Michael Herbigs Kult-Hit Der Schuh des Manitu, die Abahachi und Ranger zurück auf die Leinwand bringt.
Der Vorgänger gilt bis heute als eine der größten Kinoerfolgsgeschichten Deutschlands: Der Schuh des Manitu lockte 2001 über elf Millionen Zuschauer in die Säle, übertraf damit zahlreiche internationale Blockbuster und entwickelte sich zu einem popkulturellen Phänomen, dessen Zitate und Running Gags selbst Menschen kennen, die den Film nie gesehen haben. Neben dem überwältigenden Einspielergebnis heimste die Westernparodie zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter den Deutschen Filmpreis, und prägte für Jahre die heimische Comedy-Landschaft.
Ironischerweise hatte Herbig nach dem verheerend aufgenommenen Bullyparade – Der Film verlauten lassen, er wolle seinen langjährigen Kultfiguren Lebewohl sagen. Stattdessen versuchte er sich an neuen Projekten – doch weder die geisterhafte Familienkomödie Buddy (2013) noch das investigative Mediendrama Tausend Zeilen (2022) konnten an alte Erfolge anknüpfen - einzig Ballon (2018) wurde wohlwollend angenommen. Nun also doch die Rückkehr in jene Western-Klamauk-Welt, die ihm vor über zwei Jahrzehnten den Durchbruch bescherte.
Doch gerade weil die Erwartungen einer treuen Fanbasis mit der Skepsis einer humor-sensibilisierten Generation kollidieren, stellt sich die entscheidende Frage: Ist Das Kanu des Manitu mehr als ein nostalgisches Schaulaufen altbekannter Figuren – und trifft der Film mit seinem Humor noch den Nerv der Gegenwart oder setzt er lieber vollständig auf bewährte Konzepte, die heute für manche längst antiquiert oder gar inakzeptabel wirken?
Zur allererst muss gesagt werden: Handwerklich ist Das Kanu des Manitu ein rundum solides Projekt. Herbig versteht sein Metier, er weiß, wie man Szenen rhythmisch aufbaut, wie Bildkomposition, Timing und Schnitt zusammenspielen müssen. Die ganz großen Einfälle oder überraschenden Kniffe fehlen zwar, doch die visuelle Umsetzung ist präzise, klar strukturiert und oftmals ansprechend gestaltet. Auch tricktechnisch präsentiert sich der Film auf einem Niveau, das man im deutschen Mainstream-Kino nicht selbstverständlich erwarten kann – eine Qualität, die bereits beim Sci-Fi-Ausflug (T)raumschiff Surprise - Periode 1 (2004) unübersehbar war.
In seiner eigentlichen Königsdisziplin jedoch – dem Humor – wirkt das späte Sequel seltsam orientierungslos und vor allem kraftlos. Es pendelt unbeholfen zwischen nostalgischen Anspielungen und einem auffällig zurückhaltenden Skript, das Herbig gemeinsam mit Christian Tramitz (Hubert und Staller) und Rick Kavanian (Beckenrand Sheriff) verfasst hat. Die Furcht, durch Pointen in den sozialen Medien einen Shitstorm auszulösen, scheint während des gesamten Schreibprozesses im Raum gestanden zu haben. Das Resultat ist ein vorsichtiges Herantasten an frühere Gag-Formeln, das die rigorose Absurdität des Originals weitgehend vermeidet. Zwar dürfen altbekannte Markenzeichen wie der bayerische Akzent nicht fehlen, doch nach 24 Jahren wirkt dieser eher routiniert als pointensicher – mehr vertraut als wirklich komisch.
Niemand dürfte ernsthaft erwarten, dass Herbig das von ihm mitgestaltete Universum radikal neu erfindet. Doch ein Hauch frischer Ideen hätte dem Film spürbar gutgetan. Stattdessen erinnert Das Kanu des Manitu eher an eine lange Wanderung im Kreis – es passiert zwar eine Menge, doch nur selten entsteht echtes Mitreißen oder ungebremste Komik. Jessica Schwarz (Narziss und Goldmund) als Bandenchefin Boss hat einige charmante Szenen, und Merlin Sandmeyer, bekannt aus Die Discounter, entlockte dem Rezensenten immerhin vereinzelte Schmunzler. Darüber hinaus liefert der Film genau das, was man erwartet – allerdings in einer spürbar entschärften Version, die darauf bedacht ist, niemandem auf die Füße zu treten.
Ob dieser bedächtige Kurs dem Werk letztlich guttut, darüber lässt sich vortrefflich streiten. Herbig selbst betonte im Vorfeld immer wieder, wie wichtig ihm ein respektvoller Umgang mit anderen Kulturen sei, und bemüht sich spürbar um eine Balance zwischen Humor und Sensibilität. Dass er sich im Finale sogar wortwörtlich entschuldigend an die amerikanischen Ureinwohner wendet, ist sinnbildlich für diese Haltung – und dürfte ebenso Zustimmung wie Kopfschütteln hervorrufen. Die Geste ist gut, aber die Umsetzung wirkt erzwungen und pflichtschuldig. Ebenso gibt es eine Art „Twist“, der wohl von den Machern als besonderes Highlight gedacht war, in Wahrheit jedoch ebenso inspirations- und kraftlos wirkt wie der gesamte Film.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org