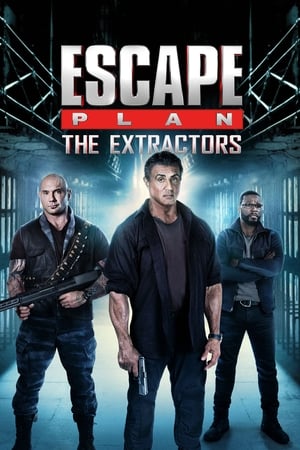Quelle: themoviedb.org
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org

- Start 21.08.2025
- 105 Min ActionSci-FiKomödieHorrorDrama
- Regie J.J. Perry
- Drehbuch Nimród AntalMatt JohnsonScott ChitwoodPaul Ens
- Cast Dave Bautista, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Samuel L. Jackson, Daniel Bernhardt, Eden Epstein, George Somner, Sergio Freijo, Lukáš Frlajs, Phil Zimmerman, Robert Holik, Paula Argüelles, Kevin Eldon
Kritik
Fazit
Kritik: Sebastian Groß
Beliebteste Kritiken
-

Kritik von WilliamWhyler
In „Afterburn“ ist die Welt zehn Jahre nach einer gewaltigen Sonneneruption nicht mehr die, die wir kannten. Die moderne Zivilisation bricht zusammen, Strom ist rar, Gesetzlosigkeit und Anarchie nehmen überhand. Jake (Dave Bautista), ein ehemaligen Soldat, schlägt sich als Schatzsucher durch: Er sucht nach Artefakte aus d...
Moviebreak empfiehlt
Wird geladen...
×