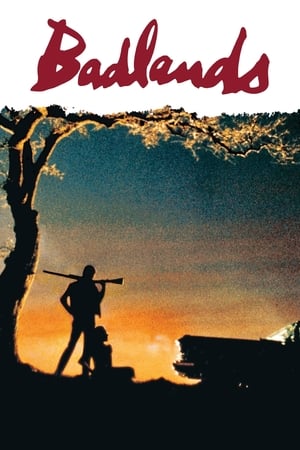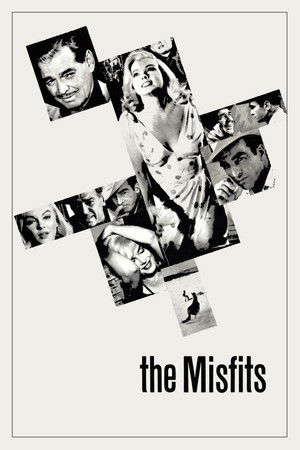Ein schwerer Sturz von einem Bullen bei einem Rodeo-Wettkampf versetzt den jungen Cowboy Brady Blackburn in eine existenzielle Lebenskrise. Auch wenn er nach seinem Unfall äußerlich unversehrt geblieben ist und die Metallplatte, die seinen gebrochenen Schädel fortan zusammenhalten muss, nach kurzer Zeit kaum noch sichtbar ist, sind es die inneren Wunden, die in Chloé Zhaos Drama The Rider in jeder Szene schmerzlich spürbar sind. Auf ein Pferd sollte er laut ärztlicher Verordnung nie wieder steigen, sonst droht ihm bei einem weiteren Sturz dieser Art der Tod. Die in China aufgewachsene und mittlerweile in den USA lebende Regisseurin nähert sich dem tragischen Schicksal des verunglückten Rodeo-Reiters und großen Pferdeliebhabers mit einer Einfühlsamkeit, die unentwegt mit melancholischer Schwere durch die wundervoll fotografierten 16-mm-Filmaufnahmen hindurch schimmert. So wird The Rider zum zerbrechlichen Leinwand-Poem, das die persönliche Krise des Protagonisten in einem Mittleren Westen der USA verortet, den Zhao mit vorsichtiger Neugier an zutiefst uramerikanischen Mythen und Werten abtastet.
Dabei lässt der Film der Regisseurin nicht nur visuell Spuren von großen Kino-Poeten wie Terrence Malick (Song to Song) erkennen, sondern präsentiert die Handlung zudem als faszinierenden Ansatz zwischen dokumentarischem Realismus und fiktiver Überhöhung. Wie sich für den Zuschauer spätestens im Abspann erkennen lässt, tragen viele der Figuren dieselben Vornamen wie die Schauspieler, die sie verkörpern. Diese Tatsache rührt daher, dass es sich bei der Geschichte von Brady Blackburn um die wahre Geschichte von Brady Jandreau handelt. In Wirklichkeit war auch Jandreau ein angehender Rodeo-Star, der sich durch einen Unfall dazu gezwungen sah, seinen großen Traum von einem Moment auf den anderen aufzugeben und sein Leben sowie vor allem seine Identität völlig neu ordnen und bewerten zu müssen. Indem er eine leicht fiktionalisierte Version von sich selbst spielt, entpuppt sich der Hauptdarsteller bereits nach wenigen Szenen als sensationelle Überraschung.
Kein Blick, der von Bradys traurigen, nach Hoffnung Ausschau haltenden Augen ausgeht, scheint auch nur im Geringsten willkürlich zu geschehen, und jede Bewegung, die er im ständigen Wechsel mit sanfter Zärtlichkeit oder rauer Entschlossenheit vollführt, ist von bewundernswerter Kontrolliertheit. Die emotional treibende Kraft geht jedoch nicht alleinig von dem herausragenden Hauptdarsteller aus, sondern zusätzlich von der besonderen Inszenierung sowie dem speziellen Ansatz der Regisseurin. In dieser Hinsicht erinnert The Rider an den letzten, gerne unterschätzten sowie übersehenen Die irre Heldentour des Billy Lynn von Ang Lee. Es mag sicherlich damit zusammenhängen, dass es sich bei beiden Filmemachern um Menschen handelt, die sich einer nationalen Seele mit dem Zugang eines Außenseiters annähern, der ursprünglich aus einem völlig anderen Land stammt. Für sein Werk kombinierte Lee Satire und Charakterdrama, um die Heldenehrung traumatisierter Veteranen als sinnloses Spektakel zu entlarven, das den Schmerz und die Orientierungslosigkeit der vom Krieg gezeichneten Männer völlig außer Acht lässt.
Auch Zhao betrachtet den Western-Mythos der endlosen Prärie mit ihrem Versprechen von ultimativer Freiheit und den glorreichen Cowboy-Stars als Konstrukt, hinter dem sie Seelen voller Narben und Existenzen in der Ausweglosigkeit zum Vorschein bringt. Ohne den Sport und die Nähe zu den Tieren, die er so sehr liebt, wird Brady zum deprimierten Drifter. Dabei stellt er sich nie die Frage, ob er jemals wieder auf einem Pferd reiten wird, sondern nur, wann es wieder soweit sein wird. Gerade wenn es darum geht, die Beziehung zwischen dem Protagonisten und den Tieren einzufangen, verliert sich Zhao bewusst immer wieder in abschweifender Langsamkeit. Wenn der Cowboy in die Augen des Pferdes blickt, mit der Hand beruhigend über das Fell des Tieres streichelt und es ihm mit mühsamer Geduld und Ausdauer gelingt, dieses schließlich zu bändigen und dessen Vertrauen für sich zu gewinnen, inszeniert die Regisseurin diesen Prozess als ebenso zärtlichen wie hartnäckigen Prozess, der unweigerlich für beide Charakterfacetten der Hauptfigur steht.
Gegen Ende, wenn Brady zuvor eines seiner Pferde aufgrund einer schweren Verletzung von seinem eigenen Vater töten lassen musste und gegenüber seiner unglaublich liebevollen, aber geistig zurückgebliebenen und somit extra aufmerksamkeitsbedürftigen Schwester zu der Feststellung gekommen ist, dass er nach seinem Unfall nur am Leben gelassen wurde, weil er ein Mensch und kein Tier sei, muss der gebrochene Cowboy eine letzte Entscheidung treffen. An der Weggabelung seiner Existenz kommt die Regisseurin zusammen mit Brady endgültig zu der Erkenntnis, dass ein Leben der geplatzten Träume und schwerwiegenden Konsequenzen immer noch ein Leben ist, in dem nach innen gerichtete Einsicht sowie Erkenntnis weitaus bedeutsamer sein kann als die vermeintliche Freiheit im Sattel der Prärie.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org