Quelle: themoviedb.org
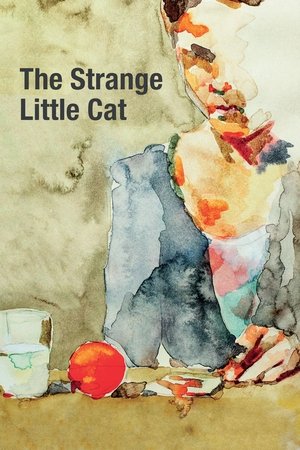 Trailer
Trailer
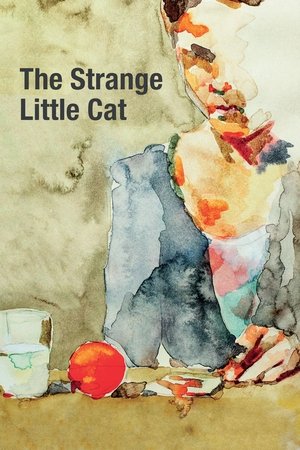
- Start 02.01.2014
- 72 Min KomödieDramaFamily Germany
- Regie Ramon Zürcher
- Drehbuch Ramon Zürcher
- Cast Jenny Schily, Anjorka Strechel, Mia Kasalo, Luk Pfaff, Matthias Dittmer, Armin Marewski, Leon Alan Beiersdorf, Sabine Werner, Kathleen Morgeneyer, Monika Hetterle, Gustav Körner, Lea Draeger, Ferdinand
Inhalt
×



