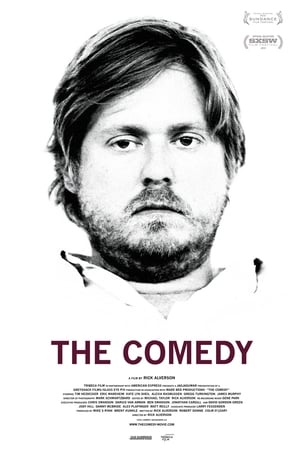Ungefähr im letzten Drittel von Ricky D’Ambroses (Notes on Appearances) elegischem The Cathedral hält ein Charakter ein Schulbuch in der Hand, welches mehrere Fotografien abbildet. Darunter befinden sich Aufgaben, welche Observation und Perspektive trainieren sollen. Einige davon lauten etwa „Was ist die Aufgabe dieses Bildes? Was sollen wir sehen?“ oder „Zeigt dieses Bild ein Ereignis oder ein Symbol, das Sie wiedererkennen“ oder auch „Was würden Sie an dem Bild verändern?“. Ab diesem Zeitpunkt innerhalb des Filmes, der die letzten Jahre amerikanischer Geschichte des 20sten Jahrhunderts aus Sicht einer Familie nacherzählt, ist man bereits zu sehr versunken in den sterilen, kahlen und nahezu gespenstisch distanzierten Aufnahmen dieses ominösen, in seiner kahlen Erzählung fast methodisch anmutenden Essayfilms, als dass man diese Aufgaben nicht auf die Inszenierung des Filmes selbst anwenden möchte, um herauszufinden, warum sich der heruntergebrochene Ansatz von D’Ambroses Inszenierung so erschreckend passend anfühlt. The Cathedral ist ein Familiendrama, Bildungsroman, Zeitdokument und Autobiografie und doch nichts von alldem. Paradox erscheint die Form des Filmes, wie auch seine Funktion, die jenseits der vorgehaltenen Emotionslosigkeit wie ein Vehikel für eine jahrzehntelange Verzweiflung erscheint.
Um sich diesem enigmatischen Film zu nähern, ist man zunächst gezwungen, dessen Stil zu durchdringen. Wie ein invertierter, finsterer Wes Anderson-Film besteht The Cathedral fast nur aus statischen, streng durchkomponierten Aufnahmen und greift ähnlich auf eine Erzählstimme zurück, welche Ereignisse wie eine News-Reportage herunterliest. „Jesse Damrosch wurde 1987 geboren“ hören wir als erstes. Dann erfahren wir vom Tod seines Onkels durch AIDS, ein Ereignis, welches wir später nie konkretisiert von den Figuren erzählt bekommen, stattdessen wird es nur vage angeschnitten und später sogar durch Jesse’s Vater Richard (Brian d’Arcy James, West Side Story) bewusst verfälscht. Diese Information am Anfang ist ein Vorbote für die unausgesprochenen Hintergründe dieser Familie, die trotz ihres engen Zusammenlebens genauso entzweit erscheint, wie Wes Andersons Royal Tenenbaums. Doch während die Filme von Anderson eine Explosion an Farbe und Ausstattung darstellen, besteht D’AmbrosesThe Cathedral fast nur aus entsättigten, grauen Tönen und die Interieurs der Familienhäuser (selten verlassen wir diese) könnten schlichter nicht sein. Nichts zeugt von irgendeinem gestalterischen Aufwand. Wenn hier eine Party stattfindet, hört man ein paar feiernde Geräusche aus einem, im filmischen Off platzierten, Raum. Diese sterile Inszenierung erscheint umso aggressiver in Verbindung mit der Narration selbst. D’Ambrose verweigert nicht nur den Zugang zu den Figuren, er scheint diesen bewusst zu negieren, wenn alle Darsteller in bewusst reduzierten und oftmals statischen Sätzen sprechen. Konflikte, Familienfeiern, Hochzeiten und andere Ereignisse erfahren wir immer durch eine Distanz. Stattdessen erzählt D’Ambrose viel durch die Nahaufnahmen von Bildern und Objekten, manchmal von Gesichtern. Alles ist perfekt angerichtet und doch fehlt etwas. Was würden wir an diesen Bildern verändern und was würden sie uns dann sagen? Vielmehr jedoch: Was wollen wir, dass sie sagen?
Ein interessanter Moment formuliert diese Frage: Der Protagonist Jesse findet ein Bild von seiner Mutter und seiner Schwester aus der Zeit, als er noch klein war. Später sehen wir dieses Foto unmittelbar vor uns als Rückblende inszeniert. Die Einstellung ist dieselbe, aber irgendetwas hat sich verändert: Nicht nur das Flimmern der Fotoaufnahme ist weg, die Realität verfügt nicht über den Schleier einer nostalgischen Erkenntnis, nicht über die Illusion einer historischen Kohärenz. Egal wie durchkomponiert die Bilder des Filmes sind, sie wirken wie eine Anomalie im Kontext eines Amerikas, dessen Ausmaße und politische Ereignisse wir nur durch alte Reportagen erzählt bekommen. The Cathedral spielt Ende der 80er und zum Großteil in den 90ern, doch nichts an den Bildern erweckt diese Zeitepochen. Alles könnte jetzt stattfinden. Jesse, dessen Aufwachsen das Zentrum des Filmes darstellt, wurde, anders als sein Vater oder seine Großeltern, „nach der Geschichte“ geboren. Für Jesse gibt es keine Kriege zu gewinnen, keine Ideologie, die man verteidigen müsste und auch keine Revolution mehr. Nur das Erfüllen der Erwartungen seiner Familie, nur das Eingliedern in den neoliberalen Kapitalismus eines Amerikas, das sich selbst überholt hat. Einmal blättert er als Kind durch ein Buch und bleibt beim Bild einer Kathedrale stehen und betrachtet sie für eine Weile. Was sieht er in diesem Moment? Eine Reflexion der Kathedrale, in der er getauft wurde und die seinen Eintritt in diese Welt symbolisierte, oder eine Miniaturversion seiner ganzen Familie als sakralen Ort? Wir sehen Jesse nie als aktive Person. Einem Messdieners ähnlich in der Abfolge familiärer Riten nimmt er still die Glückwünsche seiner Eltern über den absolvierten Schulabschluss entgegen, wie auch die Beschimpfungen seines, später geschiedenen, Vaters, der glaubt, dass sich niemand mehr für ihn interessiert. Jesse weiß, dass, selbst wenn er der erfolgreichste Mann der Welt wird, er nichts mehr bewirken kann.