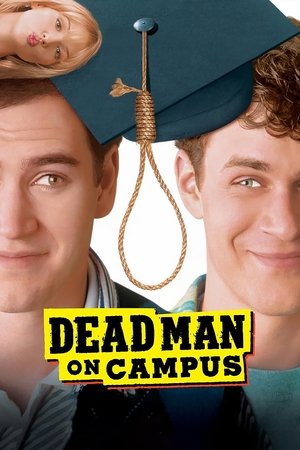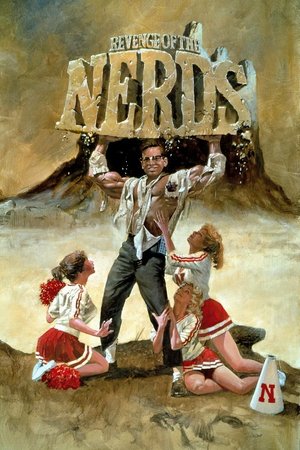Quelle: themoviedb.org
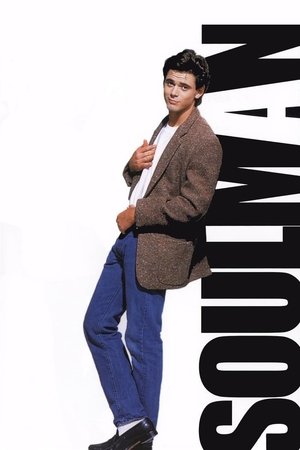 Trailer
Trailer
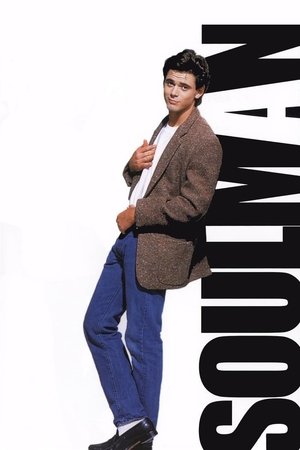
- Start 21.05.1987
- 104 Min KomödieRomanze USA
- Regie Steve Miner
- Drehbuch Carol Black
- Cast C. Thomas Howell, Rae Dawn Chong, Arye Gross, James Earl Jones, Melora Hardin, Leslie Nielsen, Ann Walker, James B. Sikking, Max Wright, Jeff Altman, Julia Louis-Dreyfus, Maree Cheatham, Wallace Langham, Eric Schiff, Ron Reagan, Mark Neely
Inhalt
×