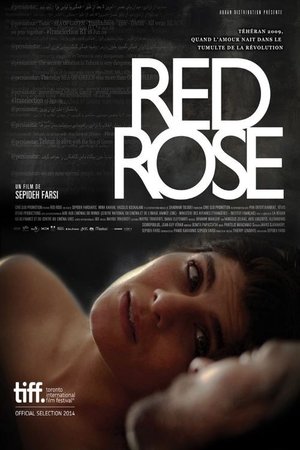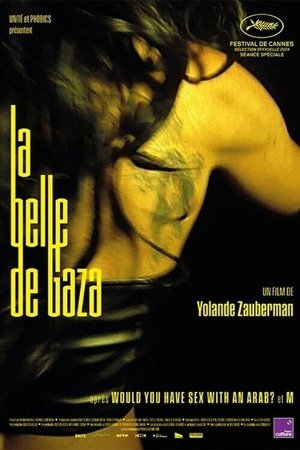Quelle: themoviedb.org
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org

- 110 Min DramaKriegsfilmDokumentarfilm
- Regie Sepideh Farsi
- Drehbuch
- Cast Sepideh Farsi, Fatima Hassouna
Inhalt
×