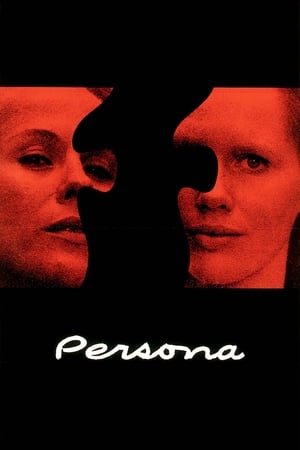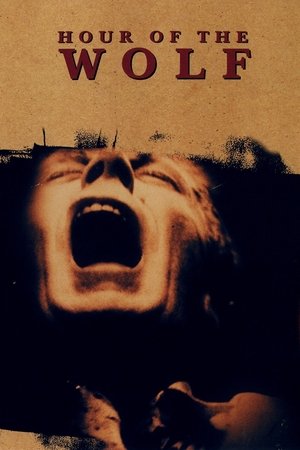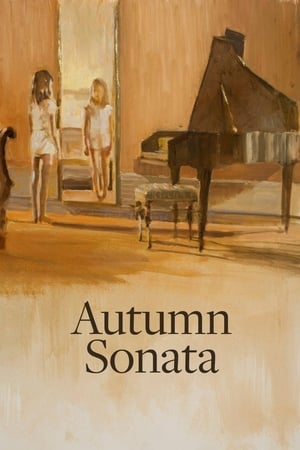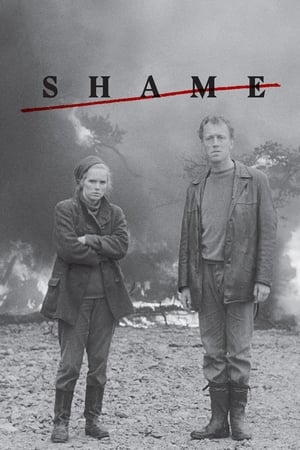„Ihr Versteck ist nicht dicht genug. Von allen Seiten dringt Leben hinein.“
Eines sollte man vorwegnehmen: Wer bisher noch keine Berührungspunkte mit den Werken von Ingmar Bergman (Szenen einer Ehe) hatte, der sollte diese lange und horizonterweiternde Reise besser NICHT mit Persona beginnen. Nicht, weil die Erfahrung nicht lohnen würde, beileibe nicht. Es ist wahrscheinlich einer der besten Filme des rastlosen Workaholics, aber auch einer seiner ganz dicken Brocken und experimentellsten Arbeiten, zumindest partiell. Was immer uns der Schwede speziell mit seiner Anfangs- und Endsequenz genau sagen will, es wird wohl nie restlos aufgeklärt werden, auch da Bergman sich selbst dazu nie ganz konkret äußerte. Aber so sollte es auch sein. Persona lädt den aufgeschlossenen Zuschauer dazu ein – oder vielmehr zwingt ihn – sich seine ganz eigene Interpretation zu ergrübeln. Auch wenn einiges irgendwann sehr offensichtlich erscheint, nichts ist bei genauer Betrachtung restlos ausformuliert, über allem schwebt dieser spekulative Aspekt, der es so wegweisend wie zeitlos unruhestiftend gestaltet.
Bergman schrieb Persona während einer schweren Erkrankung und verarbeitete damit auch einen Teil seiner Erfahrungen und Emotionen dieser Tage, vermischt es mit dem generellen Schwerpunkt seiner Arbeiten zu diesem Zeitpunkt. Eigentlich arbeitete er gerade an Die Stunde des Wolfs, zu dem (wie zu allen Teilen seiner sogenannten Fårö-Trilogie ) es eindeutige Parallelen gibt. Zwei Frauen verbringen abgeschieden von jeglichem Input der Außenwelt intime Wochen auf einem einsamen Flecken irgendwo im Nirgendwo. Elisabeth (Liv Ullmann; Herbstsonate) ist eine Schauspielerin, die ohne ersichtlichen Grund aufgehört hat zu sprechen und sich scheinbar absichtlich von ihrer Umwelt abkoppelt. Ihre Pflegerin Alma (Bibi Andersson; En passion) redet hingegen ohne Unterlass und relativ unbedarft, plaudert aus dem persönlichen Nähkästchen und scheint der entrückten Frau damit sehr gut zu tun. Was als erfolgreiche, aber nicht unbedingt strukturierte Therapie zu beginnen scheint, wandelt sich zu einer seelischen Zerreißprobe, zur Eskalation mit unvorhersehbaren Ausgang. Treibt Elisabeth nur ein Spiel mit der gutmütigen Alma, verfällt diese selbst langsam einer paranoiden Psychose, wer behandelt hier wen, wer verdrängt hier was oder wer ist denn überhaupt der, der er zu glauben scheint?
Vor gezielt reduzierten, oft spartanischen Kulissen dringt Bergman (mal wieder) unerhört, fast beängstigend tief in die Gefühlswelten und das Bewusstsein seiner Hauptfiguren ein; gräbt, bohrt und löchert, bis diese sich selbst (und auch der Zuschauer) nicht mehr voneinander differenzieren können. Eine sonderbare Metamorphose findet statt, die bereits früh durch offenbar schlichte, aber unglaublich subtile Mittel von Bergman’s Kameraspezi Sven Nykvist in still-spektakulären Montagen zum Ausdruck gebracht wird. In einer Szene formen Ullmann’s Körper und Andersson’s Gesicht in Vorder- und Hintergrund optisch eine Person, eine physisch-verspielte Verschmelzung, was besonders gen Ende natürlich noch wesentlich deutlicher und dann unübersehbar auf die Spitze getrieben wird. Die Interpretation des Geschehens scheint irgendwann eindeutig und dennoch will es der Regisseur dem Publikum nicht so einfach machen, es nicht seiner persönlichen Herausforderung berauben. Denn wie man es dreht und wendet, Persona liefert keine klaren, keine einfachen Antworten. Vielmehr setzt er sich mit persönlichen Konflikten und selbstreinigenden Prozessen auseinander, konfrontiert mit Dämonen und Lebenslügen und durchbricht ganz nebenbei die Schwelle aus reiner, filmischer Fiktion, in dem er das Gezeigt immer wieder als das darstellt, was er ist: Nur ein Film. Sehr radikal, aber ungemein effektiv.
Heraus kommt ein immenser Kraftakt, der die extrem ungemütliche Seite im Schaffen des Ingmar Bergman (er konnte durchaus auch anders) in all seiner Größe und erschlagender Wirkung auf den Punkt formuliert. Manchmal verstörender, bizarrer als die besten Horrorfilme aber nie die Grenzen zum Genrefilm überschreitend ist auch Persona ein wahrhaftiger Diskurs über persönliche Gemütszustände, die in all ihrer Kontrasten nach außen brechen und „einfach“ nur in Bildern und Szenarien manifestiert werden, die es zu hinterfragen gilt und die das auch genauso wollen. So befremdlich wie meisterhaft.
„Ich ändere mich ständig. Du kannst tun mit mir was du willst, du kommst nie an mich heran!“
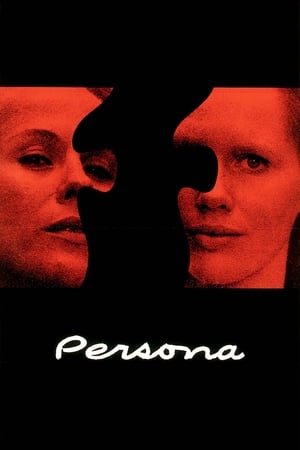 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org