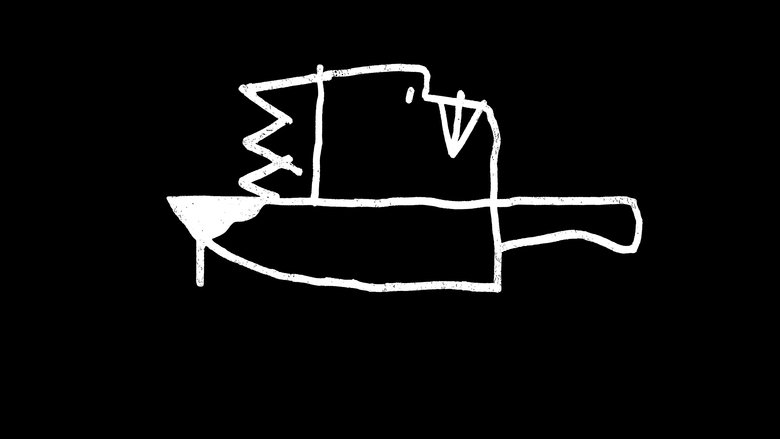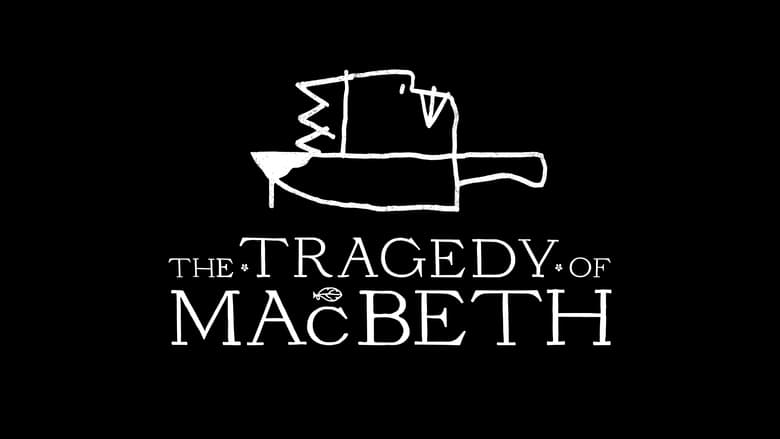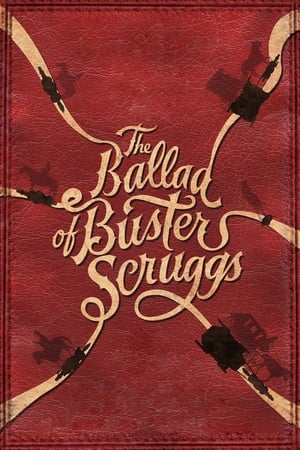Quelle: themoviedb.org
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org

- 105 Min MysteryDramaThrillerFantasyKriegsfilm
- Regie Joel Coen
- Drehbuch Joel CoenWilliam Shakespeare
- Cast Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell, Bertie Carvel, Brendan Gleeson, Corey Hawkins, Harry Melling, Miles Anderson, Kathryn Hunter, Matt Helm, Moses Ingram, Scott Subiono, Brian Thompson, Lucas Barker, Stephen Root, Robert Gilbert
×