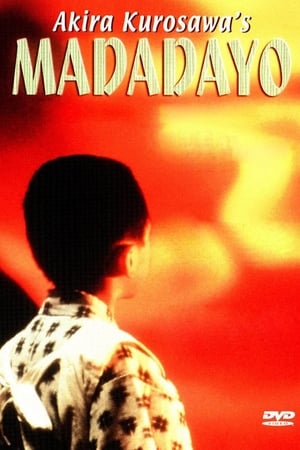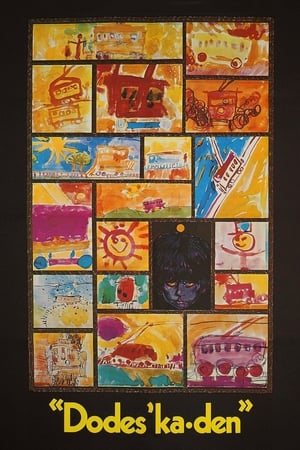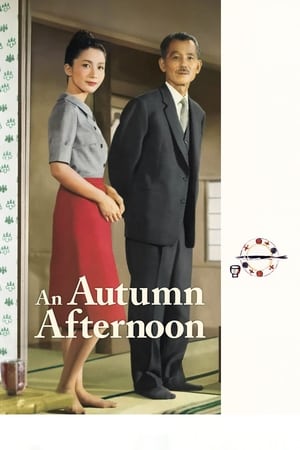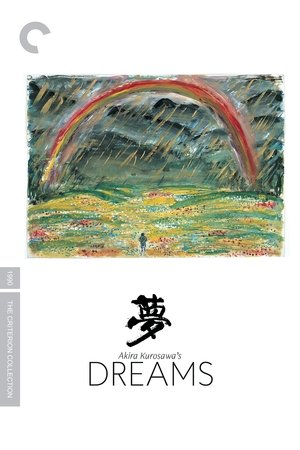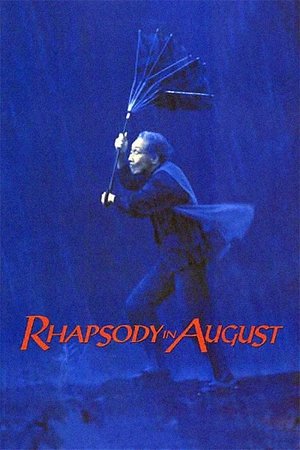Was gehört alles dazu, einen letzten Film zu drehen? Und durch welche Dimensionen wird es erweitert, wenn es sich dabei bewusst um den letzten Dreh des letzten Films handelt? Akira Kurosawa, dessen letzter Film Madadayo im Jahr 1993 veröffentlicht wurde, er ist vor allem genau das; ein Abschluss. Der dreißigste Film des japanischen sensei, erschienen genau ein halbes Jahrhundert nach seinem ersten Film, der poetischen Judo-Geschichte Judo Saga. Madadayo gilt vielerorts als Enttäuschung. Als ein lediglich hübscher Film, der allerdings wenig zu erzählen hat. Und auch wenn die zahlenmäßige Wertung dieser Kritik keinen Rahmen sprengen wird, so soll dennoch hier bewiesen werden, dass Madadayo sehr viel anspricht. So viel, dass es sich in diesem Text und bei einer Sichtung sicherlich kaum überblicken lässt.
Doch zu Beginn stellt Kurosawa erst einmal sein präzises Können unter Beweis. Eine verschlossene Tür, ein Student, der reingestürmt kommt, die bevorstehende Ankunft des Dozenten ankündigt, bevor der betagte Mann (gespielt von Tatsuo Matsumura, Dodeskaden) eintritt. Ein strenger Dozent, der seine Karriere Revue passieren lässt. Er ist ein zufriedener, bescheidener Mensch, der diese bestimmte Art des Humors besitzt, die nur mit der Lebenserfahrung kommen kann. Er verabschiedet sich von seinen Schülern, genau wie Akira Kurosawa sich von der Bühne des Weltkinos verabschiedet. Bestimmt, aber mit gemischten Gefühlen. Wenn der alte Mann zu Tränen gerührt ist, niest er in ein Taschentuch. Kurosawa erzählt seinen Film sehr gesetzt; zur Rente gehört schließlich auch das Zurücklehnen, Beinüberschlagen und Händefalten.
Kurosawas letzter Film, erzählt von einem Mann, der sich - obgleich er eine beachtliche Disziplin an den Tag legt - nicht sein Leben mit Sorgen vermiesen lassen möchte. So macht er sich keine negativen Gedanken über einen wahrscheinlichen Einbruch in sein Haus, stattdessen lädt er die Räuber mittels Schildern ein, weist ihnen den Weg, bietet ihnen Zigaretten an. Ein Appell an die Leichtigkeit des Lebens und die allgemeine Menschlichkeit in jedem - und sie steckt in jedem, davon geht Professor Uchida aus. Der Herr geht in den Ruhestand und möchte sich auf das Schreiben in aller zufriedenen Einsamkeit konzentrieren. Er wird dabei mit Liebe, Ehre, Respekt und Herausforderungen, mit seinem Gewissen und seinen Wünschen, seinem Alter und der veränderten Welt konfrontiert. Er zieht Lehren aus seinen Erfahrungen, berichtet von alten Träumen und Gedanken. Etwas anderes passiert in Madadayo nicht.
Dass nichts passiert ist dabei so nicht richtig. Denn Kurosawa, nachdem er fünfzig Jahre lang mit seinen Filmen visuell dominiert, beeindruckt und inspiriert hat, geht gleichzeitig mit dem Professor in Gedanken durch sein eigenes Leben hindurch. Nicht zufällig versetzt er die Handlung der Geschichte zurück in die 40er Jahre, also die Zeit, indem seine Karriere ihren Anfang nahm. Nicht zufällig, zitiert Kurosawa seine größten Einflüsse, um sich bei ihnen für die Inspiration zu bedanken. So mutet eine Szene, in der der Professor in seiner kleinen Hütte (Bretterbude) mit seinen Bekannten Unterschlupf findet, wie eine Comedy-Nummer der Marx-Brüder (Die Marx-Brothers im Krieg) an, die sich im Frame des Films wie in einem begrenzten Raum bewegen. Eine andere Einstellung des gleichen Handlungsortes gedenkt an den russischen Regisseur Andrei Tarkovsky (Der Spiegel). Kurosawa verneigt sich reihum vor seinen Vorbildern.
Doch gleichzeitig ist Kurosawa sich seine Rolle als Vorbild ebenso bewusst. Er sinniert darüber; was es bedeutet, wenn Hoffnungen auf einem liegen, welche Verantwortung man hat und erfüllen muss. Die Hoffnung, die in den Dozenten gesetzt wird, ist die Hoffnung, die in den ersten international erfolgreichen japanischen Filmemacher gesetzt wurde. Es geht dabei um die Identität eines Künstlers, die jenem von Dritten angedichtet wird und um die damit einhergehende Objektivierung des Künstlers. Kurosawa gleitet beinahe assoziativ durch sein Leben, kommt bei seinem allerersten Halb-Film an (Horse), streicht die Judo Saga und taucht immer wieder mittels inszenatorischer Haken in seine eigene Filmographie ein. Dabei hat der Film durchaus einige fragwürdige Episoden, die zu abstrakt in ihren Emotionen sind, als dass sie eine empathische Identifikation ermöglichen. Da kann es vorkommen, dass der Film zeitweise seine Zuschauer verliert.
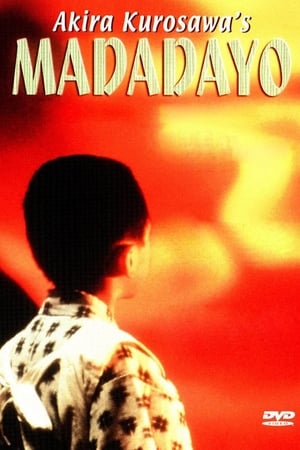 Trailer
Trailer