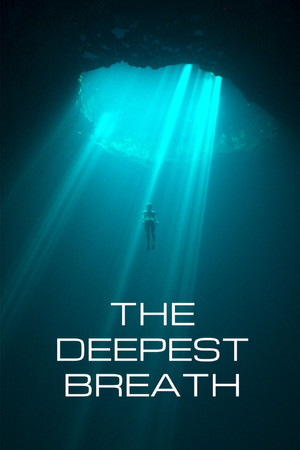Wenn das Logo von Dark Castle Entertainment auf der Leinwand erscheint – jener Produktionsfirma, die einst unter anderem von Robert Zemeckis mitbegründet wurde und sich zunächst auf Horrorfilme wie 13 Geister (2001) und Orphan - Das Waisenkind (2009) spezialisierte –, könnte man vermuten, Last Breath folge dieser Tradition und präsentiere sich als klassischer Genrebeitrag. Dieser Eindruck verstärkt sich mit den ersten Bildern: gespenstische Lichtstimmungen, unheilvolle Schatten und eine bedrückende Atmosphäre evozieren eine klaustrophobische Bedrohung, die an einen Survival-Horrorfilm denken lässt.
Doch Regisseur Alan Parkinson schlägt eine andere Richtung ein. Sein Spielfilmdebüt entzieht sich gängigen Genre-Kategorien und entwickelt sich statt eines reinrassigen Thrillers zu einem packenden Überlebensdrama – zumindest für die Zuschauer. Für Tiefseetaucher Chris Lemons, dessen wahre Geschichte dem Film zugrunde liegt, muss die Situation hingegen ein regelrechter Albtraum gewesen sein.
Eine Erfahrung, die bereits 2018 in der Dokumentation Der letzte Atemzug – Gefangen am Meeresgrund von Alan Parkinson sowie Richard da Costa ausführlich beleuchtet wurde. Diese dokumentarische Herkunft prägt auch Last Breath, denn Parkinson setzt stark auf realistisch anmutendes Bildmaterial und stilistische Elemente, die an investigative Dokumentationen erinnern. Besonders auffällig ist die häufige Verwendung von Überwachungsaufnahmen, die eine gewisse Unmittelbarkeit erzeugen. Gleichzeitig stehen sie jedoch im Kontrast zu den klassisch inszenierten Szenen, was zu einer visuellen Uneinheitlichkeit führt. Diese Diskrepanz fällt vor allem dann ins Gewicht, wenn Parkinson bewusst die Mittel einer Spielfilm-Ästhetik nutzt – etwa in jenen eindrucksvollen Momenten, in denen Finn Cole (Peaky Blinders - Gangs of Birmingham) in seinem massiven Taucheranzug auf dem dunklen Meeresgrund verharrt, umgeben von nichts als Schwärze, während das fahle Rot seiner Magnesiumfackel die Isolation der Figur eindrücklich unterstreicht.
Es bleibt allerdings das Gefühl, dass Parkinson dieses cineastische Potenzial nicht konsequent entfaltet. Auch in Sachen Spannung reizt er nicht alle Möglichkeiten aus. Last Breath funktioniert hervorragend als semi-dokumentarischer Einblick in die Welt der Sättigungstaucher, deren lebensgefährliche Arbeit hier nachgezeichnet wird. Als nervenaufreibender Thriller hingegen bleibt der Film eher zurückhaltend.
Dabei zeichnet sich Parkinsons Inszenierung durch eine bemerkenswerte Reduktion aus. Der Film wirkt durchweg fokussiert, ohne unnötige Abschweifungen oder narrative Füllsel. Die Handlung ist bewusst komprimiert, um die Katastrophe ins Zentrum zu rücken und den Blick auf jene Männer und Frauen zu lenken, die mit unermüdlichem Einsatz versuchen, eine Tragödie abzuwenden. Dennoch führt gerade diese Straffung dazu, dass das Werk am Ende Schwierigkeiten hat, einen überzeugenden Schlusspunkt zu setzen – ein Problem, das sich jedoch nur auf die letzten fünf bis zehn Minuten vor dem Abspann beschränkt.
Insgesamt ist Last Breath ein solides Überlebensdrama, das vor allem durch seine inszenatorischen Entscheidungen interessant bleibt. Parkinsons Ansatz, dokumentarische Stilmittel mit klassischer Spielfilm-Ästhetik zu kombinieren, eröffnet spannende Perspektiven, geht jedoch auf Kosten einer stringenten cineastischen Identität. Einige erzählerische Chancen bleiben ungenutzt, doch dafür punktet der Film mit einer gelungenen Besetzung: Woody Harrelson (Zombieland) verleiht seiner Rolle in der Taucherglocke eine warme, bodenständige Präsenz, während MCU-Star Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) als wortkarger Retter überzeugt. Keine Besetzung, die Kinogeschichte schreiben wird, doch im Kontext dieses Films eine, die hervorragend funktioniert. Letztlich bleibt der Eindruck, dass ein erfahrener Spielfilm-Regisseur dem Stoff mehr Ausdruckskraft hätte verleihen können – doch Parkinson gelingt es immerhin, einige nachdrückliche Szenen zu kreieren, die nachhallen.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org