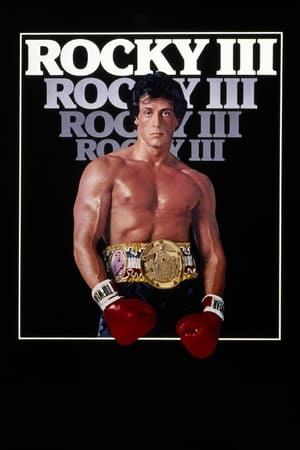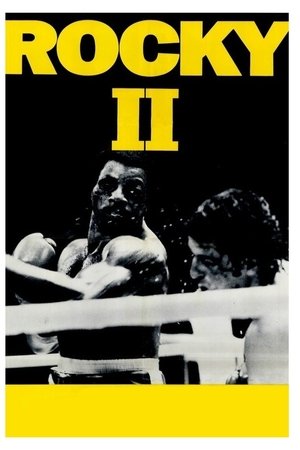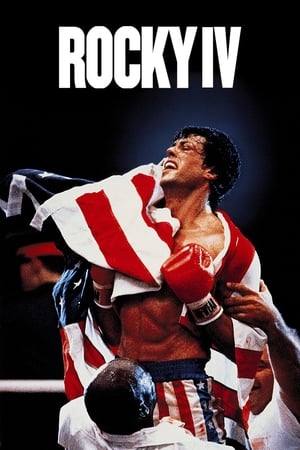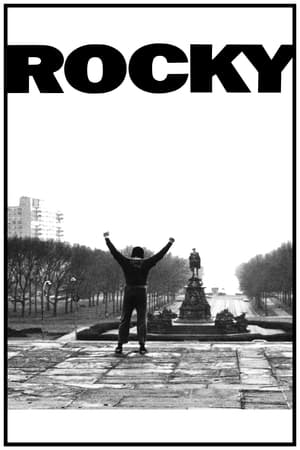Der Mega-Überraschungs-Erfolg Rocky machte aus dem bis dato völlig unbekannten Kleindarsteller Sylvester Stallone (The Expendables) quasi über Nacht einen Weltstar. Sowohl als bester Hauptdarsteller wie für das von ihm selbst verfasste Drehbuch für den Oscar nominiert, war Stallone zwei Jahre später wohl immer noch auf Wolke 7 und ging bei Vorhof zum Paradies ohne falsche Zurückhaltung gleich ganz in die Vollen. Hauptrolle, Drehbuch und erstmals auch Regie, warum auch nicht? Besonders wenn es sich wieder um eine Underdog-Story handelt, an deren Ende es handfest im Ring zur Sache geht. Diesmal halt nicht im Box- sondern im Wrestlingring. Wird schon schiefgehen. Nun ja…
Zunächst sieht alles gar nicht so direkt nach einem Rocky-Ableger aus: Geschildert wird der Alltag dreier Brüder im ärmlichen New Yorker Hell’s Kitchen während der späten 40er Jahre. Cosmo (Stallone) ist ein aufschneiderischer Maulheld; ein Träumer und Glücksritter, der aber eher vom Pech verfolgt scheint. Sein älterer Bruder Lenny (Armand Assante, Judge Dredd) hat seine wilden Tage bereits hinter sich gelassen und schlägt sich als leicht verbitterter, desillusionierter Leichenbestatter durch. Das Nesthäkchen ist Victor (in seiner ersten von nur drei Filmrollen: Lee Canalito), ein muskelbepackter, aber herzensguter und sanfter Riese, der seinen Lebensunterhalt mit Eislieferungen bestreitet. Anfangs mutet Vorhof zum Paradies mehr wie eine Milieustudie ohne ganz konkreten Handlungsmittelpunkt an, so was wie der Versuch eines Hexenkessel von Martin Scorsese, dem man trotz offenkundiger Grünschnäblichkeit und Trivialität einen gewissen Stallgeruch mit wenigstens authentischen Anflügen gar nicht absprechen mag.
Bis dahin ist der Film trotz vermutetet Handlungsarmut eigentlich ganz passabel anzuschauen, besonders da Stallone bei seiner Inszenierung bemüht zu Werke geht. Das Ganze ist gut ausgestattet, wirkt trotz jetzt schon überzogenen, cartoonesken Figuren irgendwie recht bodenständig und zumindest in seinem Anliegen eines Mini-Scorseses ambitioniert. Sobald Sly aber wieder den Ring vor Augen hat, gehen alle italienischen Hengste mit ihm durch. Dass er wieder die Story vom Außenseiter zum Gipfelstürmer auspackt, bitte schön, aber die Art und Weise ist schon arg albern und teilweise grenzenlos debil. Das Script – bei Rocky noch Oscar-nominiert, obwohl man auch das durchaus kritisch hinterfragen darf – scheint wie von einem 12jährigen geschrieben. Jemanden, der seine Helden ernsthaft den Ring-Namen „Kid Salami“ gibt (ja, Wrestling war auch damals schon oft goofy, aber das…) und zudem diesen Show-Sport so inszeniert, als wäre es blutiger Backyard-Brawl auf Leben und Tod.
Man muss Stallone wirklich unterstellen, dass er Ende der 70er einfach nicht wusste, dass Wrestling – auch 1946 schon und selbst unter diesen semi-legalen Verhältnissen – IMMER eine abgekartete Sache war. Anders funktioniert das ganze Prinzip und auch die meistens Moves nicht, die in diesem Film trotzdem gezeigt werden. Nur das das sogenannte Kayfabe-Modell damals noch wesentlich seriöser genommen wurde, die Illusion eines echten Kampfes unter „normalen“ Bedingungen nie öffentlich demaskiert wurde, aber daran hakt es ja in der Wahrnehmung. Sly ist voll dabei und macht daraus einen Schlagabtausch jenseits von Gut und Böse, bei dem sich die hier auftretende Wrestling-Legende Terry Funk (Road House) – selbst in den blutigsten und übelsten Kämpfe aller Zeiten involviert und deshalb wohl wissend, dass selbst diese nur ein Spiel mit dem Publikum waren – bestimmt heimlich ins Fäustchen gelacht hat, mit welcher Ernsthaftigkeit das Thema hier noch behandelt wurde.
Dass Stallone nicht versteht was Wrestling ist, ist aber ehrlich gesagt gar nicht mal das größte Problem des Films. Dieser Aspekt ist eigentlich ganz putzig und beweist nur mal wieder den unbändigen Enthusiasmus (oder kompensierten Minderwertigkeitskomplexes?) des etwas zu klein geratenen Testosteron-Bolzens für extrem männliche, verschwitze Wettkämpfe harter Kerle, egal wie trottelig das für Außenstehende manchmal wirken kann (siehe auch Over the Top). Sly sieht wahrscheinlich gar nicht mal die Ironie darin, der feiert das total. Genauso wie Rise-to-the-Top, vom armen Schlucker zum bejubelten Helden für den Moment; das große Drama zwischen den Seilen und die pathetische Versöhnung mit ulkigsten Dialogen in den unpassensten Situationen, Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts ist das Ende von Vorhof zum Paradies auf Koks (allerdings die ganze Zeit über). Dementsprechend ist Sly’s Regiedebüt leider keine Spaßgranate, sondern nur ziemlich schizophren in seiner Ausrichtung, was der echte Störfaktor ist.
Was als Kleinkriminellen-Drama beginnt verliert jegliche Bodenhaftung, besonders die Hauptfiguren tauschen einfach mal die Rollen. Der von Sly gespielte Cosmo reitet seinen Bruder zunächst rücksichtlos und manipulativ in die Scheiße nur um seine eigenen Taschen zu füllen, turnt aber von 0 auf 100 zum Gewissens- und Vernunft-Verwalter, während der bis dahin komplett verlässliche und realistisch-reflektierte Lenny (Assante ist trotzdem super, weil einfach ein geiler Schauspieler) dessen raffgierige Arschloch-Position einnimmt…und niemand versteht warum, also zumindest warum so plötzlich und SOOOO drastisch. Alles an diesem Film nimmt in der zweiten Hälfte völlig absurde Züge an, dazu noch befeuert mit offenbar bewussten Humor-Einschüben, die deplatzierter kaum sein könnten. Da wird eine dramatische Suizid-Szene aufgebaut und kurz unterbrochen durch eine Slapstick-Einlage, die am Ausgang des Ganzen und der angestrebten Tragik aber nichts ändert (also so sollte es wohl sein). Mann, Mann, Mann, was ist denn hier los?
 Trailer
Trailer